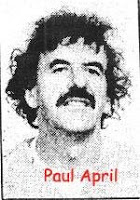The Master – USA 2012

USA 50er Jahre: Freddie ist ein Loser, dessen Leben zwischen Gewalt, Sex und Saufen pendelt. Er schafft es nicht längere Zeit einen Job zu behalten, treibt ziellos umher bis er auf den Sektengründer Dobbs trifft, der versucht ihn für seine Vereinigung „The Cause“ zu gewinnen.
Beeindruckende Bilder, hochkarätige Schauspieler und stimmungsvolle Ausstattung und Kameraarbeit – das sind die unzweifelhaften Qualitäten die für The Master sprechen. Er sieht oft extrem schick aus und natürlich macht es Spaß jemand wie Philip Seymour Hoffman beim Spiel zu beobachten.
Dagegen steht allerdings das Gefühl, dass der Film erzählerisch auf der Stelle tritt und sich nie traut in eine Richtung zu gehen die wirklich interessant wäre. Es ist auffällig, dass der große Aufschrei von Scientology gegen The Master ausgeblieben ist auch wenn sie verhaltenen Unmut zu Protokoll haben. Denn auch wenn die Werbung und die Vorab-Presse anderes suggeriert spielt der Kult von Lancaster Dodd, dessen Mechaniken, Wirkung und Ideologien nur eine untergeordnete Rolle und es wird deutlich, dass sich Anderson nicht wirklich dafür interessiert.
Wofür er sich interessiert ist der von Phoenix als Mischung aus Nixon-Look-Alike und Quasimodo gespielte Id-Mensch Freddie, einem eher unsympathischen Zeitgenossen der bewusst nur in Primärreizen denkt und handelt. Saufen, ficken, prügeln und depressiv aus der Wäsche gucken. Vielleicht ist es Geschmackssache, aber Anderson überschätzt hier meiner Ansicht nach die Faszination die der Zuschauer für diesen Freddie aufbringt, das Interesse daran ob und welche Wandlung er durchläuft (eigentlich keine erwähnenswerte) und ob er lebt oder stirbt. Phoenix spielt intensiv, aber seine Figur bleibt konstant creepy – egal ob er sich am Strand einen runterholt, mit Sanduschis kuschelt oder für „The Cause“ arbeitet.
Er bleibt eine verlorene Seele, die zu wenig Empathie anregt und dessen beste Momente die sind, in denen es eben nicht um ihn geht sondern um Dobbs und seinen Kult. Immer wieder blitzt auf, wie spannend der Film hätte werden können, wenn sich Anderson auf die Dobbs-Figur konzentrieren würde und deren Psychogramm zeichnete. Wenn nachvollziehbar würde, warum Menschen sich für „The Cause“ begeistern, was Dobbs antreibt, was die Auswirkungen und Pläne sind. So bleiben starke Einzelszenen wie der Test den Dobbs mit Freddie macht und der sehr an typische Scientology-Stresstests erinnert – doch sie sind nur kleine Fragmente die Potential erahnen lassen, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen. Hoffman spielt Dobbs gekonnt zwischen jovialem Übervater mit Anklängen an Charles Foster Kane und unbeherrschtem Choleriker – und trotzdem bleibt die Figur schwammig, trotzdem wird sie in ihrer Motivation nie greifbar.
Noch schlimmer steht es im die Nebenfiguren, die angerissen aber nie ausgeführt werden und (wie Dobbs Sohn) gerne auch mal völlig aus der Handlung purzeln.
The Master bleibt blass, eigenschaftslos und in seiner sowohl-als-auch Haltung überraschend mutlos. Er vermeidet es konsequent irgendeine Position zu beziehen – und ob wahr oder nicht, drängt sich die Frage auf ob das auch irgendwie mit Andersons Kumpel Tom Cruise zusammenhängt, dem er den Film vorab pflichtschuldig vorgeführt hat. Wobei es sicher keine nachträglichen Änderungen sind, die den Film so richtungslos machen, sondern eher eine Schere im Kopf die Anderson vielleicht davon abgehalten hat das Thema das er anreißt auch tatsächlich durchzudeklinieren.
Am Ende bleibt ein schön anzusehender, schwurbeliger Film, mit gravierenden Pacing-Problemen, der mit Tiefgang und Arthaus flirtet und doch mit dem Gefühl von Leere und verpasster Gelegenheit zurücklässt.
Warm Bodies – USA 2013

Nach der Zombieapokalypse. Zombie R stolpert mit anderen Untoten durch die Welt, grunzt und macht Jagd auf Lebende und fragt sich insgeheim nach dem Sinn seiner Existenz. Das ändert sich erst, als er bei einer Konfrontation mit Menschen der jungen Julie begegnet und sich in sie verliebt…
Okay das hier ist im Grunde Twilight in gut und für Jungs. Reine Horrorfans werden mit Warm Bodies wohl eher nicht happy, genausowenig wie Mädels die ausschließlich die ganz, ganz großen Gefühle serviert bekommen wollen.
Natürlich ist die Liebesgeschichte dennoch der Kern dieser Zombie-Story, doch eine große Portion Schmalzpotential entfällt alleine dadurch, dass die Geschichte aus Sicht des Zombies R geschildert und mit viel trockenem Humor aus dem Off von ihm kommentiert wird. Brüllend originell ist das im übergreifenden Handlungsbogen natürlich nicht und auch die innere Logik quietscht schon ganz ordentlich, wenn man tatsächlich genau hinterfragen würde, wie diese Zombies jetzt funktionieren. Sie sind langsam wie Romero-Untote, können aber doch bisweilen recht flink rennen. Und je mehr sie verwesen, desto agiler und schneller werden sie, bis sie als wandelnde Skelettmonster schließlich jeden Sprinter überholen könnten. Und wie gesund es ist wenn tote Körper plötzlich wieder Herzschlag bekommen und „lebendig“ werden möchte man medizinisch auch lieber nicht durchdeklinieren.
Das schöne ist: Es ist im Grunde auch eher egal, da der Film zwar keine reine Komödie ist, sich aber auch nie so ernst nimmt, das ihm seine Logiklöcher zum Verhängnis würden. Nicholas Hoult liefert eine sympathische und differenzierte Performance ab als R und schafft es im Zusammenspiel mit seinem Voiceover einen sehr faszinierenden Charakter zu erschaffen, der zwar nicht so viel mit dem zu tun hat was man als Zombie kennt, aber dennoch fasziniert. Als Allegorie auf männliche Unsicherheit im Umgang mit Frauen („Don’t be creepy“) in Zeiten politischer Korrektheit ist das natürlich auch lesbar und amüsant. Spaß macht aber nicht nur Hoult und sein Zombie-Kumpel Rob Corddry sind passend besetzt, auch Teresa Palmer macht als Julie eine gute Figur. Sie ist verletzlich genug um ihre Angst nachzuvollziehen und doch nie die doofe Damsel in Distress oder selbstmitleidige Fluntschfresse wie Bella. Es ist Faszination und Nervenkitzel, gemischt mit Angst die sie dazu bringt sich auf R einzulassen – und auch wenn sie viele Chancen gehabt hätte zu fliehen, fühlt es sich richtig an, dass sie bei ihm bleibt. Im Gegensatz zu Twilight wird hier tatsächlich spürbar warum die Figuren sich verlieben, weil sie beide eine Persönlichkeit haben und nicht nur Projektionsfläche für lamoyante Backfische sind.
Für einen PG13-Film ist das Ganze übrigens doch teilweise recht drastisch ob sich ein Zombie die Gesichtshaut abreisst oder R das Gehirn des Lovers von Julie als Entspannungsdroge weglutscht oder die Bonys im Finale gnadenlos zusammengeklatscht werden – der Humor ist an einigen Stellen überraschend böse, auch wenn Warm Bodies nie ganz aus dem Fluffigkeits-Ghetto ausbricht. Natürlich nutzt er das Potential das sein Konzept bietet nur teilweise, natürlich geht es nie in Richtung Nekromantik und natürlich ist Nicholas Hoult auch als Zombie verdammt süß anzusehen. Es ist ein Teenie-Film, der mehr Spaß dran hat seine Love-Story charmant zu erzählen, als dem Horror-Genre neue Impulse zu verleihen wie dies „Shaun of the Dead“ tat.
Aber für das was er ist, ist er völlig in Ordnung und unterhält bestens.
Stitches – UK 2012

Der runtergekommene Partyclown Stitches wird auf einem Kindergeburtstag Opfer eines tödlichen Scherzes der Kinder. Jahre später kehrt er zurück um sich zu rächen… Clown-Style.
Wow! Die Briten haben es wirklich drauf. Stitches ist wohl der originellste Fun-Splatter der letzten Jahre, mit extrem abgefahrenen Splatter-Szenen die sich wohltuend vom Torture-Porn-Trend abheben und eher aufs Zwerchfell, denn aufs Ekelzentrum zielen – und das obwohl es extrem blutig zugeht.
Und auch wenn einer der Darsteller aus dem Doctor Who-Ableger „Sarah Jane Adventures“ hier die Hauptrolle spielt, ist Stitches eindeutig kein Kinderfilm. Die besetzung, allen voran Comedian Ross Noble als Mörderclown, macht eine gute Figur und entwickelt mehr Persönlichkeit als man es von Slasher-Filmen gemeinhin gewohnt ist. Die Clown-Mythologie ist originell und stimmig (und basiert tatsächlich auf echten Clown-Traditionen) und die Kids sind sympathisch genug und sehen tatsächlich mal aus wie Teenager und nicht wie Endzwanziger die auf jugendlich getrimmt sind. Und auch wenn sie typische Klischeerollen ausfüllen, sind sie eigenständig genug, dass man ein bißchen Mitgefühl hat, wenn Stitches sie einen nach dem anderen zur Strecke bringt.
Ebenfalls nett: Die Musikauswahl (I just died in your arms tonight wurde selten so effektiv eingesetzt) und die Farbdramaturgie, sowie wohltuend viele altmodische Make-Up-Effekte anstelle von dem heute üblichen CGI-Splatter.
Stitches macht Spaß, eignet sich wunderbar als Partyfilm und wird hoffentlich auf DVD/BD sein Publikum finden, da er hierzulande ja leider abseits des FFF keinen Kinostart bekommen hat.
Der Beitrag Reviews: The Master, Warm Bodies, Stitches (Review) erschien zuerst auf Die Fünf Filmfreunde.